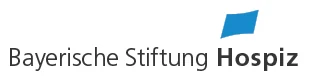Sterben: zu Hause, aber nicht allein
50 Prozent der Menschen in Deutschland würden gern zu Hause sterben. Doch nur für 20 Prozent erfüllt sich dieser letzte Wunsch. Möglich wäre viel mehr. Hospiz- und Palliativdienste spielen beim Sterben daheim eine kaum zu überschätzende Rolle. Warum? Das hat uns Julia Knoll vom CHV-Hospizdienst erklärt.
Um wen kümmern sich ambulante Hospiz- und Palliativ-Teams?
Das Ambulante Hospiz- und Palliative Care-Team des Christophorus Hospiz Vereins (CHV) in München betreut jeweils 40 bis 50 Familien gleichzeitig. Familien? Genau. Hospiz- und Palliativdienste (ebenso wie stationäre Hospize und Palliativstationen) sehen nicht nur die schwerstkranken Menschen, sondern auch ihr Umfeld: Die Angehörigen, die pflegen, organisieren, Ängste, Kummer und tausend Fragen haben. Hospizdienste sind für sie alle da.
Schon gewusst? Nicht nur Angehörige können Sterbende betreuen
Wenn schwerstkranke Menschen zu Hause sterben, kümmert sich oft die Familie. Doch auch der Freundeskreis oder die Nachbarschaft können einspringen. Zum Beispiel, wenn die Angehörigen weit entfernt leben, die Betreuung allein nicht schaffen, mal eine Auszeit brauchen, oder wenn es gar keine Verwandtschaft gibt. Ambulante Hospiz- und Palliativdienste machen keinen Unterschied: Wer sich kümmert, wird unterstützt. Tipp: Feste Ansprechperson(en) für Hausarzt/-ärztin, Pflegedienst und das Hospiz-/Palliativ-Team vereinbaren!
Julia Knoll (zum Porträt), ist Palliativfachkraft beim Christophorus Hospiz Verein in München. Sie berät und unterstützt schwerstkranke und sterbende Menschen und deren Betreuungs-Netzwerk vor Ort. Außerdem koordiniert sie das Ambulante Hospiz- und Palliative Care-Team. Die Nachfrage ist groß. In jedem Fall muss Julia Knoll herausfinden: „Ist das schon was für uns? Die wesentlichen Kriterien sind: eine begrenzte Lebenserwartung, ein rasches Voranschreiten der Erkrankung und belastende Symptome, die schon vorhanden oder zu erwarten sind.“
Treffen alle Kriterien zu, besuchen ein/e Palliativmediziner/in und eine Palliativ-Fachkraft die Familie zu Hause und klären die Lage und den Bedarf: Was braucht der schwerstkranke Mensch, was belastet ihn zurzeit? Wer ist Hausärztin oder Hausarzt? Kommt schon ein Pflegedienst ins Haus, eine Therapeutin? Wer aus dem privaten Umfeld kann sich kümmern – und wie? Könnte eine ehrenamtliche Hospizbegleitung die Angehörigen entlasten? Nicht zu vergessen die wichtigen Dokumente und die finanziellen und rechtlichen Fragen: Gibt es eine Patientenverfügung und/oder Vorsorgevollmacht? (Stellt sicher, dass die eigenen Wünsche bis zuletzt respektiert werden – und entlastet die Angehörigen.) Wer zahlt den Hospizdienst? Welche Rechte haben berufstätige Angehörige?
Wer bezahlt die Hospiz- und Palliativversorgung?
Die Hospiz- und Palliativversorgung ist für die Betroffenen kostenfrei. Verordnen Hausärztin oder Hausarzt eine Spezialisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV), dann übernimmt die Krankenkasse die Kosten. Die Allgemeine ambulante Palliativversorgung (AAPV) wird aus Spenden finanziert.)
Was ist normal, wenn ein Mensch stirbt?
Sterben kann man nicht üben. Aber Julia Knoll kann die Familien vorbereiten. Was passiert möglicherweise – und was kann ich dann tun? Was ist normal im Sterbeprozess, wann muss ich handeln? Wie kann ich erkennen, ob es einem Menschen gut geht, der nicht sprechen kann oder bewusstlos ist? „88 Prozent der schwerkranken Menschen haben kurz vor dem Sterben eine Fülle von Symptomen.“ Julia Knoll schildert dem kranken Menschen und der Familie, welchen Verlauf die Krankheit und das Sterben nehmen können. Sie beschreibt, klärt auf, gibt Tipps – und konzentriert sich auf wesentliche Informationen, die Bedürfnisse des einzelnen Menschen und seine Lebensqualität.
Gemeinsam nicht nur den körperlichen Schmerz lindern
Nicht nur körperliche Schmerzen können sterbende Menschen belasten, sondern auch psychische (z. B. Ängste, Abschiedsschmerz), soziale (z. B. Sorge um die Familie, Einsamkeit) und spirituelle (Sinnfrage, „Warum ich?“, Was kommt nach dem Sterben?). Fachleute sprechen von Total Pain, dem allumfassenden Schmerz. Palliativteams sind deshalb multiprofessionell. Das bedeutet: Im Team arbeiten Fachkräfte aus verschiedenen Berufen wie Medizin, Pflege, Soziale Arbeit, Therapie und Seelsorge.
„Wir begleiten das Leben unheilbar kranker Menschen bis zum Tod. Wir lindern belastende Symptome, geben Hilfe zur Selbsthilfe. Ein Ziel ist, die Autonomie, die Selbstbestimmtheit, zu erhalten.“
Was ist für einen sterbenden Menschen angenehm? Manche Menschen wollen berührt, umarmt und bekuschelt werden, andere wünschen sich Abstand. Wer sein Leben lang Körperkontakt mochte, kann ihn im Sterben vielleicht nicht mehr gut aushalten – oder umgekehrt. (Diese Erfahrung hat Anna A. gemacht, die ihre Großeltern pflegte. Lesen Sie hier Anna A.s Geschichte: „Mutig und liebevoll“). Tipp von Julia Knoll: „Legen Sie Ihre Hand nicht auf die des Sterbenden, sondern darunter. Dann kann er selbst entscheiden und seine Hand liegenlassen oder wegziehen.“
Oft kommt der ambulante Pflegedienst mit der Betreuung gut klar. Doch wenn zum Beispiel eine unheilbare Tumorerkrankung voranschreitet, nehmen belastende Symptome oft zu – oder es treten neue auf. Bei solch vielfältigen und schweren Beschwerden kann die Hausärztin oder der Hausarzt eine Spezialisierte Ambulante Palliativ-Versorgung SAPV) verordnen: durch hoch qualifizierter Fachkräfte aus Palliativmedizin und Palliativpflege wie Julia Knoll. Sie legen Zugänge für die Medikamentengabe, bringen Schmerzen, Übelkeit und Atemnot unter Kontrolle. Das SAPV-Team ist rund um die Uhr erreichbar (Rufbereitschaft). Die meisten Fragen können telefonisch geklärt werden. Bei Symptomkrisen machen die Fachkräfte auch nachts Hausbesuche.
Eine Frage zu Schmerzmitteln …
Mit Schmerzmitteln kennen sich doch die Hausärztin oder der Hausarzt aus: Warum unterstützt hierbei das SAPV-Team? Schwerstkranke Menschen brauchen (und vertragen) Medikamente in sehr hohen Dosen. Profis aus der Palliativmedizin und Palliativpflege haben das spezielle Wissen und viel Erfahrung in der Dosierung von Schmerzmitteln wie zum Beispiel Morphium.
SAPV-Teams arbeiten möglichst vorausschauend. Doch SAPV bedeutet auch: Jederzeit tun können, was genau jetzt nötig ist. Das Ziel: Dem schwerstkranken Menschen soll es so gut wie möglich gehen.
Das Sterben zulassen. Und gute Lebenszeit gewinnen
„Wir verlängern das Leben nicht“, betont Julia Knoll. „Wir lassen das Sterben zu. Doch auch wenn man nicht mehr gesund werden kann: Heilwerden kann vieles. Man kann zum Beispiel seinen Partner von einer ganz anderen Seite kennenlernen – wie den Mann, der seine Frau sehr patent pflegt. Oder man kann sich mit seinen erwachsenen Kindern versöhnen …“
Weniger leiden = mehr (vom) Leben
Stress verkürzt das Leben. Und Schmerzen sind purer Stress. Die Palliativmedizin lindert Schmerzen und andere Beschwerden. Julia Knoll erlebt sogar immer wieder, dass Palliativpatienten einige gute Tage oder Wochen gewinnen. Nicht an Leidenszeit, sondern an Lebenszeit. Einfach, weil Schmerzen, Angst oder Atemnot gut oder auf ein erträgliches Maß gelindert werden können.
Julia Knolls Berufsalltag bringt sie jede Woche mit anderen Menschen zusammen. Zum Beispiel mit dem älteren Herrn mit Lungenkrebs. Der Sohn lebt weit entfernt, doch er kommt jeden Tag vorbei. Ein ambulanter Pflegedienst versorgt den Patienten viermal täglich. Julia Knoll besorgt einen Schlüsselsafe; so ist sichergestellt, dass bei Bedarf auch das Palliativteam rund in die Wohnung kommen kann. Als seine Schmerzen gelindert sind, verliert der Patient seine Angst, kommt auch gut allein durch die Nächte. Für den Notfall trägt er einen Hausnotrufknopf am Handgelenk. Tagsüber lässt der alte Herr sich sein Pfeifchen schmecken. Pflegeprofi Julia Knoll hat überhaupt nichts dagegen: In der allerletzten Lebensphase ist genau das „gesund“, was Freude macht.
Pflegedienst & Hospiz-/Palliativdienst: Was ist der Unterschied?
Ambulante Pflegedienste betreuen pflegebedürftige Menschen zu Hause. Sie waschen Patientinnen und Patienten, ziehen Stützstrümpfe an, geben Medikamente, wechseln Verbände und vieles mehr. Leiden Menschen an unheilbaren, fortschreitenden Krankheiten, ergänzen und unterstützen ambulante Hospizdienste und SAPV-Teams den Pflegedienst. Die Hospiz- und Palliativkräfte behandeln belastende Symptome, knüpfen ein Betreuungs-Netzwerk und beraten zu allen pflegerischen, medizinischen, sozialen, ethischen und rechtlichen Fragen. Sie stehen in engem Austausch mit der Hausärztin oder dem Hausarzt. Julia Knoll: „Der Hausarzt hat den Hut auf, bei ihm läuft alles zusammen!“

Julia Knoll ist Gesundheits- und Krankenpflegerin, Palliativ-Fachkraft, hat einen Magister in Literaturwissenschaft und Philosophie. Ihre Wissens- und Erfahrungsvielfalt fließt in ihre Arbeit im Ambulanten Hospiz- und Palliative Care-Team des Christophorus Hospiz Vereins (CHV) in München.
In der Krise hilft: Struktur
Eine Krise ist eine Veränderung im Leben, die erschüttert, verunsichert, Angst macht. Eine Krise kann sein: Zu wissen, dass man bald stirbt, sich ganz verloren zu fühlen. Bloß nicht ins Krankenhaus zu wollen: Aber wie schafft man das, schwerkrank zu Hause? Wie sollen die Liebsten rund um die Uhr aushalten, was man selbst nicht erträgt? Julia Knoll sieht Krisen nicht als Chance: „Ich halte nichts von solchem Achtsamkeitskäse. Doch Menschen in einer Krise sind hoch motiviert. Sie wollen dort raus! Um aus der Krise rauszukommen, braucht man Struktur. Einen Schritt nach dem anderen. Klare, nicht zu kleinteilige Handlungen: Was braucht der Mensch jetzt am dringendsten? Was ist jetzt zu tun? Die Menschen müssen wissen, dass sie gehört werden und dass im Notfall jemand kommt.“
Was tun, wenn die Betreuung zu Hause nicht ausreicht?
Manchmal gelangen auch ambulante Hospizdienste und SAPV-Teams an ihre Grenzen. Dann versucht Julia Knoll, einen Hospizplatz oder ein Bett auf einer Palliativstation im Krankenhaus zu organisieren. Der Personalschlüssel ist in beiden Einrichtungen gleich – und auch die Haltung. Lindern statt heilen ist das Ziel – und, die Wünsche und Würde des sterbenden Menschen zu respektieren.
Und was hilft den Angehörigen?
Vom Hospizdienst gehört und gesehen werden: Das gilt auch für die Angehörigen. Julia Knoll hat sie im Blick: Den alten Herrn, der sich um seine schwerstkranke Frau kümmert. Die Eltern, die miterleben müssen, wie ihr Kind stirbt. Lebt ein Kind im Haushalt, bezieht Julia Knoll sofort eine Sozialarbeiterin oder einen Sozialarbeiter mit ein. Oft helfen ältere Jugendliche und junge Erwachsene bei der Pflege mit. Julia Knoll schaut nach: Wie geht es ihnen? Kommen sie klar oder brauchen sie Hilfe oder eine Auszeit? (Julia Knoll hat auch Anna A. unterstützt. Die junge Frau half intensiv bei der Pflege ihrer schwerstkranken Großeltern. Zur Geschichte von Anna A.: „Mutig und liebevoll“)
Und nach dem Tod des liebsten Menschen? Hospizvereine bieten Trauerbegleitung und Trauergruppen an – auch speziell für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene.
„Auch ein alter Mensch war mal ein junger Wilder, hat geliebt. Das größte Schmerz gilt dem, was wir nicht gelebt haben. Mein Tipp: Spielen Sie das Spiel des Lebens mit, so gut es geht. Nehmen Sie das Süße wie das Saure mit, dann haben Sie hinterher in der Umkleidekabine was zu erzählen.“
Julia Knoll, Palliativ-Pflegefachkraft