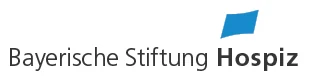Häufige Fragen FAQs
Hier finden Sie Fragen und Antworten rund um die hospizliche und palliative Versorgung.
Allgemein: hospizliche und palliative Versorgung
Im Blickpunkt der Palliativmedizin und Palliativpflege stehen schwerstkranke und sterbende Menschen mit schwerwiegenden, sehr belastenden Begleiterscheinungen – z. B. Schmerzen, Atemnot, starke Übelkeit und andere körperliche Symptome, aber auch Angstzustände.
Früher galt die Aufmerksamkeit fast ausschließlich Menschen mit Krebserkrankungen in ihrer letzten Lebensphase. Heute werden Palliativmediziner schon viel früher und bei unterschiedlichsten Diagnosen hinzugezogen.
Die Palliativmedizin kümmert sich um schwerstkranke und sterbende Menschen mit stark belastenden Symptomen. Ihr Ziel ist nicht, Leben zu retten oder zu verlängern, sondern schwerwiegende Symptome der Erkrankung zu lindern und so die Lebensqualität der betroffenen Menschen zu steigern.
Die Palliativmedizin kann belastende Symptome meist spürbar lindern. Lassen die starken Schmerzen oder die Atemnot nach, schwindet oft auch die Angst: Die schwerstkranken Menschen können sich wieder öffnen fürs Hier und Jetzt, wichtige Fragen regeln, schöne Momente genießen.
Nein! Palliativ behandelt werden unheilbar kranke Menschen.
Die palliative Versorgung hat das Ziel, Krankheitserscheinungen wie starke Schmerzen, Atemnot oder massive Übelkeit zu lindern. Außerdem kümmert sie sich um psychische und/oder soziale Belastungen und um spirituelle Fragen und Anliegen. Das Ziel ist, Lebensqualität (wieder) herzustellen.
Manche Palliativpatienten haben nur noch kurze Zeit zu leben. Bei anderen wird zum Beispiel auf der Palliativstation immer mal wieder die Behandlung angepasst; anschließend können sie nach Hause zurückkehren.
Was eine palliative Sedierung ist, erfahren Sie im Lexikon: (palliative) Sedierung
Nein, ganz im Gegenteil.
Oft entsteht der Wunsch nach Sterbehilfe, weil Menschen unter den Symptomen einer schweren Erkrankung leiden. Ziel der Hospizbegleitung ist, (körperliche, psychische, soziale und seelische) Belastungen zu lindern und Lebensqualität (wieder) herzustellen.
Als äußerste Möglichkeit gibt es auch eine palliative Sedierung. Mehr erfahren: Zum Lexikoneintrag „palliative Sedierung“, Palliativmediziner Dr. Rainer Schäfer über palliative Sedierung
Ja, die Hospiz- und Palliativbewegung hat den kranken Menschen und sein gesamtes Umfeld im Blick. Auch als Angehörige können Sie sich mit Ihren Fragen und Sorgen an Ihre Ansprechpersonen wenden. Viele Hospizvereine bieten auch Trauergruppen für Angehörige an.
Einen Teil der Kosten für die hospizliche Begleitung – ob ambulant oder stationär – übernehmen die jeweiligen Kostenträger (also zum Beispiel die Krankenkasse). Den fehlenden Betrag bringen die Hospize/-vereine selbst auf, unter anderem aus Stiftungen oder Spenden.
Für die Betroffenen selbst oder ihre Angehörigen fallen keine Kosten an.
Nein. Als Mitglied in einem Hospizverein unterstützen Sie die Hospizarbeit mit Ihren Beiträgen und eventuell auch ehrenamtlichem Einsatz. Sie erwerben damit jedoch kein Anrecht auf eine Hospizbegleitung. Die Überweisung an eine Palliativstation oder in ein Hospiz kann nur der behandelnde (Haus-)Arzt oder das behandelnde Krankenhaus ausstellen. Gibt es eine Warteliste, so entscheidet das Hospiz ausschließlich nach Dringlichkeit.
Hier finden Sie die Adressen aller Hospizvereine und Hospizgruppen, Palliativstationen an Krankenhäusern und der, stationären Hospize in Bayern. und Hospizakademien in Bayern. Sie können nach Ort, Postleitzahl, Regierungsbezirk und Art der Einrichtung suchen: zur Adressdatenbank
Stationär: Hospiz, Palliativstation
Wenn ein unheilbar kranker Mensch mit starken und/oder vielfältigen Symptomen zu Hause nicht ausreichend behandelt werden kann, ist eine Verlegung auf eine Palliativstation möglich.
Dort kümmern sich Fachkräfte aus Medizin, Pflege, Therapie, Sozialer Arbeit und Seelsorge um alle Belastungen. Um Schmerzen, Atemnot, Übelkeit und auch Ängste zu lindern, wird ein individueller Behandlungsplan entwickelt. Bewährt er sich, kann die Patientin oder der Patient wieder nach Hause zurückkehren.
Unheilbar kranke Menschen mit geringer Lebenserwartung und sehr belastenden Symptomen, können in ein Hospiz eingewiesen werden. Über die Einweisung in ein Hospiz entscheiden die behandelnden Ärztinnen und Ärzte in Abstimmung mit der betroffenen Person und ihren Angehörigen.
Ein Mensch gilt als „palliativ“, wenn er unheilbar krank ist, nur noch eine begrenzte Lebenserwartung hat und an starken Symptomen leidet. Eine palliative Behandlung kann in dieser Situation viele Belastungen lindern und die Lebensqualität stärken. „Palliativ“ stammt vom lateinischen pallium: dem Umhang, der sich schützend und behütend um eine Person legt.
Nein. Hospizvereine sind offen für alle Menschen, die hospizliche Begleitung brauchen – unabhängig davon, ob sie religiös sind und welcher Religion sie angehören. Hier finden Sie Informationen über die hospizliche Begleitung von und durch Menschen mit Migrationshintergrund.
Der behandelnde Arzt stellt eine Notwendigkeitsbescheinigung aus und die zuständige Krankenkasse genehmigt den Antrag auf vollständige Hospizpflege. Dann kann Rücksprache mit dem stationären Hospiz genommen werden.
Bis zu Ihrem Lebensende.
In seltenen Fällen schöpfen Menschen im Hospiz dank der palliativmedizinischen Versorgung, der spezialisierten, patientenzugewandten Pflege und der intensiven Begleitung so viel Kraft, dass sie weit länger leben, als von ihren Ärzten vorhergesagt (lesen Sie hier die Geschichte einer alten Dame: „Frau B. möchte sterben, wie sie gelebt hat.“). Wenn jemand sich so gut erholen sollte, dass er nicht mehr auf die stationäre Palliativpflege angewiesen ist, würde das Hospiz ihn ggf. nach Hause bzw. in seine Alten- und Pflegeeinrichtung zurücksenden. Dies kommt jedoch nur äußerst selten vor.
Menschen, die gut zu Hause versorgt werden können, werden gar nicht erst in ein Hospiz überwiesen.
Einen Teil der Kosten für die hospizliche Begleitung – ob ambulant oder stationär – übernehmen die jeweiligen Kostenträger (zum Beispiel die Krankenkasse). Den fehlenden Betrag bringen die Hospize/-vereine selbst auf, unter anderem aus Stiftungen oder Spenden.
Für die Betroffenen selbst oder ihre Angehörigen fallen keine Kosten an.
Nein. Im Hospiz ist der Mensch nicht „Patient“, sondern „Bewohner“ oder „Gast“. Er soll sein Leben möglichst in seinem Rhythmus und nach seinen Gewohnheiten gestalten können. Alles, was gut tut, wird ermöglicht und unterstützt – wie zum Beispiel Besuche von lieben Menschen. Dazu gehört auch, dass zum Bespiel berufstätige Angehörige auch abends zu Besuch kommen (wenn der Gast dies möchte). In manchen Hospizen und Palliativstationen können Angehörige auch im Zimmer des sterbenden Menschen übernachten.
Wie Familienleben im Hospiz stattfinden kann, das schildert Pflegeprofi Katarina Theissing: zum Report
In ihrer letzten Lebensphase hören Menschen irgendwann auf zu essen und zu trinken. Das ist ganz normal im Sterbeprozess. Man sollte sterbende Menschen nicht zum Essen oder Trinken drängen oder sie gar „gewaltsam“ füttern. Das Schlucken funktioniert am Lebensende nicht mehr gut, der Mensch könnte ersticken. Etwas Gutes tun kann man trotzdem: zum Beispiel den Mund befeuchten (mit Schwammstäbchen oder Spray) oder Eiswürfel zum Lutschen geben. Auf der Website des Christophorus Hospiz Instituts für Bildung und Begegnung finden Sie das Video: „Mundpflege – ein Geschmackserlebnis“
Ambulant: Begleitung zu Hause
Viele Menschen möchten am liebsten zu Hause sterben. Sehr oft ist dies auch möglich – mit Unterstützung durch Hausärztin/Hausarzt und bei Bedarf einen Pflegedienst und/oder Hospizdienst. Bei starken Beschwerden kann die Hausärztin oder der Hausarzt auch ein SAPV-Team hinzuziehen.
Wenn Sie in Ihrem Leben die wesentlichen Fragen am liebsten mit sich selbst ausgemacht haben, wenn Sie gut und gern mit sich selbst auskommen und wenn Sie keine Angst vor dem Alleinsein – vielleicht auch in Ihren letzten Stunden – haben: oftmals ja. Je nach Bedarf gibt es unterschiedliche Angebote für die medizinische Versorgung, die Pflege und die Begleitung.
Am besten, Sie wenden sich an einen Hospizdienst in Ihrer Nähe: Adressen der Hospizvereine/-gruppen in Bayern
Übrigens: Nicht nur Verwandte begleiten Menschen in ihrer letzten Lebensphase. Auch Freunde oder Nachbarn können – unterstützt von Hospizdiensten – starke Netzwerke bilden.
Viele Symptome können auch zu Hause (oder: in einer Alten- und Pflegeeinrichtung oder einem Wohnheim) gut behandelt werden. Wenn nötig, kann die Hausärztin oder der Hausarzt eine Spezialisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV) verordnen. Bei Bedarf kann der kranke Mensch auch vorübergehend auf eine Palliativstation verlegt werden.
Ja, eine Schmerzpumpe eignet sich sehr gut für die Schmerzbehandlung zu Hause. Die Ärztin oder der Arzt stellt die Grunddosierung ein; sie wird regelmäßig automatisch gegeben. Nehmen die Schmerzen zu, kann der kranke Mensch oder seine Angehörigen selbst zusätzliche Dosen auslösen: ganz einfach per Knopfdruck.
Das hängt von der jeweiligen Einrichtung ab. Immer mehr Alten- und Pflegeeinrichtungen verankern den Hospizgedanken in ihrer Arbeit. Altenpflegekräfte bilden sich in Palliative Care weiter; viele Heime arbeiten inzwischen auch mit Hospizvereinen zusammen, die ehrenamtliche Hospizbegleiter entsenden. Sie sind nicht nur Ansprechpartner für schwerstkranke und sterbende Menschen, sondern auch für deren Angehörige.
Mehr erfahren:
Beispielhaftes Projekt: mehr Pflegezeit im Altenheim
Ehrenamtliche Hospizbegleitung
Ehrenamtliche Hospizbegleiterinnen und HospizbegleiterEhrenamtliche sind im Hospizteam die „Fachleute fürs Alltägliche“. Sie begleiten schwerstkranke und sterbende Menschen, sind Partner im Gespräch und im Schweigen, beim Spielen oder Kochen, sie lesen vor, gehen zur Hand, unternehmen Besorgungen oder kleine Ausfahrten mit dem Rollstuhl. Sie wollen, gemäß dem Motto der Hospizbewegung, „den Tagen mehr Leben geben“. Auch für Angehörige sind sie oft wertvolle Ansprechpartner.
Gut zu wissen: Ehrenamtliche Hospizbegleiter/-innen ersetzen auf keinen Fall die Pflegekraft. Sie müssen und dürfen keine pflegerische Tätigkeit ausüben.
Sie sollten Feingefühl haben und gut auf andere Menschen eingehen können. Sie sollten belastbar sein – aber auch in der Lage, Grenzen zu ziehen und sich selbst zu schützen.
Hier stellen wir Ihnen ehrenamtliche Hospizkräfte vor, schauen Sie rein!
Weil es mir Freude macht: Dirk Addicks
Das Glück der vielen kleinen Dinge: Simone Boden
Ja, sehr intensiv, mit Theoriekursen und begleiteter Praxis. Die einzelnen Hospizvereine gliedern ihre Kurse unterschiedlich, z. B. in ein Einführungs- und ein Vertiefungsseminar bzw. einen Orientierungs- und einen Ausbildungskurs. Die Kurse dauern mehrere Monate bis zu einem Jahr. Sie
- machen sich vertraut mit der Hospizarbeit und der Rolle der Hospizbegleitung,
- lernen unterschiedliche Krankheitsbilder kennen,
- setzen sich mit den körperlichen Prozessen des Sterbens auseinander,
- diskutieren ethische Fragen und vieles mehr,
- beschäftigen Sie sich intensiv mit Techniken und Kommunikation und.
- machen im Praxisteil machen Sie unter Anleitung die ersten eigenen Erfahrungen in der Hospizbegleitung.
Über die Ausbildung zur/m Hospizbegleiter/-in
Ehrenamtliche Hospizbegleiterinnen und Hospizbegleiter entscheiden selbst, wie viel Zeit sie aufwenden möchten und können – meist zwischen zwei und vier Stunden pro Woche. Das bedeutet: Auch jüngere Menschen, die berufstätig sind oder studieren, können sich ehrenamtlich in einem Hospizverein oder einer Hospizgruppe engagieren.
Alle Infos zum Ehrenamt
Wenden Sie sich einfach an einen Hospizverein bzw. eine Hospizgruppe in Ihrer Nähe. Sie informieren und bieten oft auch selbst die Vorbereitungskurse an.
Adressen der Hospizvereine/-gruppen in Bayern
Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht
In einer Patientenverfügung legen Sie fest, welche medizinischen Maßnahmen Sie wünschen oder ablehnen. wird Die Verfügung herangezogen, falls Sie selbst nicht mehr entscheiden bzw. sich äußern können. Zum Beispiel, weil Sie im Koma liegen oder eine fortgeschrittene Demenzerkrankung haben.
Weitere Infos zur Patientenverfügung
- Vorsorge-Vollmacht. In diesem Dokument benennen Sie eine oder mehrere Personen Ihres Vertrauens, die bereit sind, für Sie im Bedarfsfall zu handeln. Mehr erfahren: Vorsorgevollmacht
- Betreuungsverfügung: Wenn Sie keine Vertrauensperson haben, können Sie in dieser Verfügung festlegen, wie eine gerichtlich bestellte Betreuung in Ihrem Sinne handeln soll. Mehr erfahren: Betreuungsverfügung