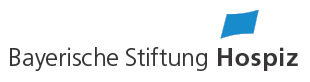Statt Intensivmedizin: intensive Begleitung.
Dr. Rainer Schäfer war verantwortlich für zwei sehr unterschiedliche Welten. In der einen Welt, der Anästhesiologie und operativen Intensivmedizin am Würzburger Juliusspital, geht es ums Heilen. In der anderen, der Palliativstation des Spitals, werden unheilbar kranke Menschen betreut. Doch unheilbar heißt nicht, dass man nichts mehr für sie tun könnte. Im Gegenteil. Wir haben mit Rainer Schäfer über die intensive Begleitung gesprochen.
Auf dieser Seite
- Viel intensiver, als es im Krankenhaus sonst möglich ist
- Aus professioneller Distanz wurde eine Patenschaft
- Keine erkennbaren Symptome mehr
- Palliative Sedierung als äußerste Möglichkeit
- Hospizverein stellt Ehrenamtliche und Brückenteam
- Was ein Sterben in Würde wert ist
- Palliativmedizin wird immer bekannter
- Komplette Versorgung, amubulant und stationär
Viel intensiver, als es im Krankenhaus sonst möglich ist
Früher hat Rainer Schäfer Vollzeit auf der Palliativstation gearbeitet. Als Chefarzt der Anästhesiologie und operativen Intensivmedizin und Leiter der Palliativstationen, waren seine Kontakte zu den Patientinnen und Patienten nur noch punktuell – und trotzdem „viel intensiver, als es im Krankenhaus sonst möglich ist.“ Das Team auf der Palliativstation erfährt während der durchschnittlich knapp sieben Tage, die ein Patient hier verbringt, viel über den Menschen, seine Lebensgeschichte, seine Angehörigen. Die Zeit für Gespräche müssen Ärzte, Pflegekräfte, Therapeuten und Ehrenamtliche nicht mühsam abknapsen: sie ist eingeplant, so wie die ganzheitliche, patientenorientierte Begleitung zum Konzept auf Palliativstationen gehört. Diese Intensität erlebte Rainer Schäfer als Bereicherung.
Aus professionelle Distanz wurde eine Patenschaft
Professionelle Distanz ist wichtig. Mit dem Herzen dabeisein, aber beim Nachhausegehen auch wieder loslassen können, Abstand nehmen. Wer das nicht hinbekommt, hält im Krankenhaus und ganz besonders auf der Palliativstation nicht lange durch. Brüchig wird der Schutzwall bei Rainer Schäfer, wenn er Patienten in seinem Alter und mit ähnlicher Biografie kennenlernt. Wenn alte Bekannte seine Patienten werden. Wenn ein Sterbender Kinder hat – oder erwartet. Manchmal ist es dann auch in Ordnung, wenn ein Patient oder ein Angehöriger nicht nur den Palliativ-Profi berührt, sondern die private Person.
„Einen Patienten haben wir über einen längeren Zeitraum immer wieder begleitet. Als er das dritte Mal zu uns kam, war seine Frau hochschwanger. Es war klar, dass er nur noch sehr kurze Zeit zu leben hatte. Alles, was sich das Paar noch wünschte war, dass er sein Kind noch sehen könnte.“ Gemeinsam mit der werdenden Mutter und den Kollegen aus der Gynäkologie besprach das Palliativteam die Situation. Schließlich entschieden sie gemeinsam, die Geburt des Kindes einzuleiten. Das Baby kam gesund zur Welt. Doch sein Vater konnte es nicht mehr in den Armen halten; er war zwei Stunden vorher gestorben. Als für die junge Mutter das größte Glück auf den größten Schmerz traf, stand ihr das Palliativteam behutsam zur Seite. Die Verbundenheit, die dabei wuchs, blieb bestehen. „Die Mutter des Kindes hat einen Mitarbeiter unserer Station gebeten, die Patenschaft zu übernehmen“, erinnert sich Rainer Schäfer. „Die beiden haben den Kontakt gehalten und uns immer wieder besucht, bis das Kind in die Schule kam und die beiden weggezogen sind.“
Keine erkennbaren Symptome mehr
Die Intensität im Zusammenspiel aus medizinischer Behandlung, zugewandter, individueller Pflege und Therapie, psychosozialer Betreuung und Seelsorge macht den Erfolg der palliativen Begleitung aus. „Wir haben in den letzten 20 Jahren enorm viel Erfahrung darin gewonnen, belastende Symptome einzudämmen“, meint Rainer Schäfer. Für schwerstkranke Patienten mit langer Leidensgeschichte – und auch für ihre Angehörigen – sei die Palliativbehandlung manchmal ein fast überwältigendes Erlebnis. Rainer Schäfer erinnert sich an eine ältere Dame, die ein solch langes Leiden hinter sich hatte, als sie auf die Palliativstation kam. „Uns ist eine sehr gute Begleitung bis an ihr Lebensende gelungen ist. Die Angehörigen waren völlig erstaunt, als sie die Dame bei uns auf der Station erlebten: Sie hatte keine erkennbaren Symptome mehr. Zunächst hat die Familie auch mit sich gehadert, weil die Dame vorher sehr lange stark leiden musste.“ Ein halbes Jahr nach dem Tod der Patientin begegnete Rainer Schäfer deren Tochter. Sie berichtete, dass die Familie sich inzwischen mit der Krankengeschichte der alten Dame versöhnt habe. In guter, tröstlicher Erinnerung sei das sanfte Sterben geblieben.
Palliative Sedierung als äußerste Möglichkeit
„In 95 Prozent der Fälle bekommen wir die Symptome – ganz oder zumindest einigermaßen – in den Griff. Die letzte Maßnahme ist die palliative Sedierung. In jüngerer Zeit wird sie ausdrücklich von Patienten oder ihren Angehörigen gewünscht“, berichtet Rainer Schäfer. Palliative Sedierung bedeutet: Der Patient erhält starke Beruhigungs- und teilweise auch Schmerzmittel, die sein Bewusstsein dämpfen oder ausschalten. Sie werden – als äußerstes Mittel – vor allem bei extremer Atemnot und unerträglicher Angst vor dem Ersticken eingesetzt. „Es gibt auch die intermittierende Sedierung. Wir können einen Patienten zum Beispiel eine Nacht lang schlafen lassen und am nächsten Tag sehen, wie sich die Symptome zeigen, wie der Patient sie empfindet.“ Viele Menschen, so Schäfer, reiche schon das Wissen um die Möglichkeit einer palliativen Sedierung. Das Wissen: Wenn ich es nicht mehr aushalte, dann muss ich das auch nicht.
Hospizverein stellt Ehrenamtliche und Brückenteam
Die Palliativstationen im Würzburger Juliusspital arbeiten eng mit dem örtlichen Hospizverein zusammen. Rainer Schäfer ist dankbar für die Unterstützung auf hohem professionellen Niveau. Zwölf bis vierzehn ehrenamtliche Begleiterinnen und Begleiter kommen regelmäßig auf die Station. „Sie sind gut geschult, organisieren sich selbst und stellen ihren eigenen Dienstplan auf.“ Außerdem stelle der Hospizverein Würzburg e. V. erfahrene Pflegekräfte für das Brückenteam der Palliativstationen. „Sie beantworten Anfragen, wickleln die Aufnahme ab und kümmern sich um den Übergang von der stationären in die ambulante Betreuung.“ Damit schwerstkranke Menschen gut zu Hause leben können, sind vor der Entlassung viele Fragen zu klären und viele kleine und größere Hilfen zu organisieren. Die Pflegekräfte aus dem Brückenteam senden den Medikamentplan an den Hausarzt, helfen bei der Suche nach einem ambulanten Pflegedienst und kommen bei Bedarf auch in die Wohnung. Welche Haltegriffe passen in die Dusche? Ist ein Badewannenlifter nötig? Sind die Türstöcke so schmal, dass ein extra schlankes Rollatormodell bestellt werden muss? In engem Kontakt mit Hausärzten, Pflegediensten und Sozialdienst stehen sie Patienten und Angehörigen zur Seite.
Was ein Sterben in Würde wert ist
Wenn ein Patient nicht nach Hause zurückkehrt, sondern auf der Palliativstation stirbt, bleibt er bis zu 24 Stunden lang in seinem Zimmer. „Die Angehörigen, haben Zeit, sich zu verabschieden. Auch die Pflegekräfte können Abschiedsrituale pflegen; den Toten waschen, ankleiden“, schildert Rainer Schäfer. Diese 24 Stunden sind nicht durch Fallpauschalen oder Pflegesätze abgedeckt. Das heißt: „Das Krankenhaus bekommt kein Geld dafür.“ Leistungen wie diese, die aus Sicht der Hospiz- und Palliativbewegung aber einfach zu einem Sterben in Würde gehören, müssen Krankenhäuser selber tragen oder aus Spenden finanzieren.
Palliativmedizin wird immer bekannter
Abstand von der Arbeit auf der Palliativstation findet Rainer Schäfer in der Bildungsarbeit. Die Stiftung Juliusspital Würzburg eröffnete 2001 gemeinsam mit der Palliativstation eine Akademie für Palliativmedizin, Palliativpflege und Hospizarbeit. Hier können u. a. Ärztinnen und Ärzte in Kursen und Fallseminaren die Zusatzbezeichnung `Palliativmedizin´ erwerben. „Das Interesse ist groß, gerade bei der jüngeren Generation“, freut sich Rainer Schäfer. „Kolleginnen und Kollegen aus allen Fachrichtungen kommen zu uns, Hausärzte, Urologen, HNO-Ärzte, auch Psychiater.“ Die Palliativmedizin werde immer bekannter; Patienten fragten auch bei ihren niedergelassenen Ärzten häufiger z. B. nach einer Schmerztherapie. Die Rückmeldungen der Teilnehmer sei sehr positiv, berichtet Rainer Schäfer. „Gerade in Disziplinen, in denen die Kommunikation mit dem Patienten bislang nicht im Vordergrund stand, wird die Beziehung zwischen Arzt und Patient durch den intensiveren Austausch gestärkt.“
Komplette Versorgung, amubulant und stationär
Das Palliativ- und Hospizzentrum am Juliusspital betreibt neben den beiden Palliativstationen und der Akademie auch einen ambulanten Palliativdienst (mit Spezialisierter Ambulanter Palliativvversorgung, SAPV) sowie ein stationäres Hospiz. Mit Hospizgruppen und -vereinen, Pflegediensten, niedergelassenen Ärzten und anderen Krankenhäusern im mainfränkischen Raum ist das Zentrum eng vernetzt. Einmal pro Quartal treffen sich die Akteure. Die Ziele: Das Angebot insgesamt und die Zusammenarbeit untereinander weiter verbessern und Wissen weitergeben – sowohl in Fachkreisen wie auch in der breiten Öffentlichkeit.

Wenn Rainer Schäfer einen Moment der Ruhe sucht, greift er gern zu einem der dicken Erinnerungsalben im „Raum der Stille“. Sie werden von den Angehörigen verstorbener Patienten gestaltet, mit Texten, Zeichnungen, eingeklebten Fotos und Trauerkarten. „Eindrücke, die lange zurückliegen, werden dann wach“, beschreibt Schäfer. „Das ist wie ein alter Film, den man wieder abspielt.“ Es gibt Menschen, die Monate oder Jahre nach dem Tod eines Angehörigen auf die Station kommen, um im Raum der Stille ein wenig im Album zu blättern, kurz einzutauchen in den Film der Erinnerung. Jeder Besucher wird freundlich begrüßt und dann ganz in Ruhe gelassen. Eine der vielen kleinen, bedachtsamen Gesten, die – im Juliusspital wie weltweit – die Hospiz- und Palliativbewegung auszeichnen.
Lesen Sie weiter …

„Ich will hier sterben, nicht essen“, sagen viele Menschen, die in ein Hospiz verlegt werden. Ulrike Grambow (Foto) arbeitet als Pflegekraft und in der Hauswirtschaft. Sie weiß, wie sie mit Leibgerichten die Tür zu Menschen und ihren Erinnerungen öffnen kann.

Sterben ist unser Alltag. Aber nichts Alltägliches
Was Lebensqualität ist, das lässt sich Regina Raps (Foto) von ihren Patientinnen und Patienten erklären. Die Palliativpflegerin und Stationsleiterin nimmt uns mit in ihren Alltag auf der Palliativstation am Würzburger Juliusspital.