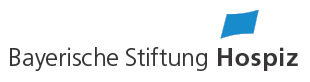Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Die Palliativstation am Krankenhaus Barmherzige Brüder in München liegt im Erdgeschoss. Das ist kein Zufall. „Wir können unsere Patientinnen und Patienten mit dem Bett in den Garten schieben, wenn sie die Sonne, den Schnee, den Regen und den Wind spüren wollen“, erklärt Chefarzt Dr. Marcus Schlemmer. Während ihrer schweren Erkrankung oder den letzten Tagen ihres Lebens sollen die Menschen auf seiner Station nicht eingeschränkt sein auf ihr Patientenzimmer. Sie sollen die Welt sehen, hören, spüren, erleben können. „Die Patienten hierherzulegen und ihnen ein bisschen Morphin zu geben – das ist nicht alles.“
Auf dieser Seite
Wir machen viele verrückte Sachen
Wer es auf der Palliativstation am Krankenhaus Barmherzige Brüder nicht mehr bis nach draußen schafft, in die Welt, zu dem wird sie hereingebracht. Regelmäßig lädt Marcus Schlemmer in Zusammenarbeit mit Live Music Now junge Musikerinnen und Musiker auf die Station ein. Auch Alphornbläser waren schon zu Gast; die runden, warmen Klänge lockten viele Patienten aus ihren Zimmern. Im großen Wohnzimmer steht ein Klavier. „Eine alte Dame, 93, setzte sich auf den Hocker und spielte, wunderbar“, erzählt Marcus Schlemmer. „Drei Wochen später ist sie gestorben.“
„Wir machen viele verrückte Sachen“, sagt Marcus Schlemmer, der Anfang 2014 die ärztliche Verantwortung für die Palliativmedizin am Krankenhaus Barmherzige Brüder übernommen hat. Als eine bettlägrige Patientin Abschied nehmen wollte, nicht von Angehörigen oder engen Freunden, denn sie hatte keine, aber von ihrem sehr geliebten Pferd, da bestellte Marcus Schlemmer ein Pferdetaxi. Das Fahrzeug mit dem Pferdeanhänger bog ins Nymphenburger Schlossrondell ein und parkte vor einer unscheinbaren Pforte in der hohen, dicken Mauer. Dann wurde das Pferd aus dem Anhänger geführt, durch die Pforte in den Stationsgarten und weiter bis ans Zimmer der Patientin. „Dort drüben stand es.“ Von seinem Büro aus deutet Marcus Schlemmer auf ein Fenster schräg gegenüber, fast ganz von Büschen verborgen. Innig verabschiedete sich die sterbenskranke Frau von dem Tier. Dann zog sie sich ins Zimmer, in ihr Bett zurück. Das Pferd blieb stehen. Es rührte sich nicht von der Stelle, stundenlang. Erst nachdem es eine Beruhigungsspritze bekommen hatte, ließ es sich in den Transporter zurückbringen. „Seither“, sagt Marcus Schlemmer, „habe ich einen Mega-Respekt vor Pferden.“
„Wer Nähe zulässt, den berühren auch Trauer und Schmerz.“
Marcus Schlemmer hat Philosophie und Theologie studiert, bis zur Zwischenprüfung. Dann nahm er das Medizinstudium auf, spezialisierte sich später auf die Onkologie. Erkenntnisse aus seinen drei Studiengängen fließen für ihn in der Palliativmedizin zusammen: „Mich spricht der Mensch als Gesamtheit an, als Einheit von Körper und Seele. Wenn Patienten in ihrer Existenz bedroht sind, dann werden die seelischen Aspekte besonders wichtig.“ Wo Menschen ganzheitlich betrachtet werden, müssen die verschiedensten Fachrichtungen zusammenwirken. „Was mich von der Palliativmedizin überzeugt hat, ist die vorbildhafte multiprofessionelle Teamarbeit. Auf der Palliativstation arbeiten Ärzte, Pflegekräfte, Seelsorger, Therapeuten und Sozialarbeiter praktisch ohne Hierarchie zusammen.“ Die Pflege hält Marcus Schlemmer für den wichtigsten Zweig in der Palliativbegleitung. „Die Pflegerinnen und Pfleger sind rund um die Uhr beim Patienten. Sie halten gemeinsam mit ihm die Luftnot aus. Sie sind an der Seite seiner Angehörigen. Sie spüren ungebremst alle Emotionen.“
Es ist auch professionell, Nähe zu zeigen

Auch die Ärztinnen und Ärzte sind in sehr intensivem Kontakt mit ihren Patienten. Wo ziehen sie die Grenze? „Natürlich muss ein Arzt professionelle Distanz wahren. Es ist aber auch professionell, Nähe zu zeigen“, überlegt Marcus Schlemmer. „Der Patient ist betroffen, also bin ich es auch. Wenn der Patient erfährt: ja, der Schlemmer mag Bruce Springsteen – dann erzählt er vielleicht auch von sich.“ Wenn er in Patientenzimmer kommt, setzt Marcus Schlemmer sich grundsätzlich hin. „Damit signalisiere ich dem Patienten zweierlei. wir sprechen miteinander auf Augenhöhe. Und: ich habe Zeit für Sie.“
„Wenn sich der Arzt im Patientenzimmer hinsetzt, dann zeigt er: 1. Wir sprechen auf Augenhöhe miteinander. Und 2. Ich habe Zeit.“
Wer Nähe zulässt, den berühren auch Schmerz und Trauer. Die Palliativstation pflegt Rituale, eine eigene Kultur, Psychohygiene für den Einzelnen und das Team. Für alle im Team wird Supervision angeboten. Jede Woche wird der Verstorbenen gedacht, „im Rahmen der Übergabe am Mittag. Dann spricht man noch einmal über jeden Einzelnen: Was war er für ein Mensch, was habe ich mit ihm erlebt?“, schildert Marcus Schlemmer. Einmal pro Monat veranstaltet die Station einen Gottesdienst und lädt auch die Angehörigen ein. Für jeden verstorbenen Patienten wird eine Kerze entzündet. „Das ist ein schwerer Weg für Angehörige. Sie kehren an den Ort zurück, an dem ein geliebter Mensch gestorben ist. Das ist ein Zeichen des Respekts und der Wertschätzung, auch gegenüber dem Team.“ Auch die Aussage „Das kann ich jetzt nicht“ wird akzeptiert, gehört zur Kultur auf der Station. „Wenn zum Beispiel jemand an diesem Tag keinen blutenden, übelriechenden Tumor verbinden kann. Oder nicht den Patienten pflegen, der genauso alt ist wie er selbst und eine ganz ähnliche Biografie hat. Und man muss auch rausgehen dürfen und weinen.“
Was ich auch meiner Familie empfehlen würde
Marcus Schlemmer wirbt für Wahrhaftigkeit im Umgang mit Patienten und deren Angehörigen. Auf die Nachricht, dass sie nicht mehr lange zu leben haben werden, reagierten viele Menschen „erst traurig, dann aber oft dankbar und erleichtert. Oft sagen sie: `Das habe ich schon länger gefühlt´.“ Und wenn ein todkranker Mensch seinem Kind sage: `Ich weiß, dass ich sterben muss und dass du traurig bist´, dann könne das Kind sich mit der Situation auseinandersetzen, statt an seiner eigenen Wahrnehmung zu zweifeln. Zur Wahrhaftigkeit gehört für Marcus Schlemmer auch, „zu empfehlen, was ich auch meiner Familie empfehlen würde. Verantwortung zu übernehmen: Ich muss mich trauen, einem Patienten zu raten: `Machen Sie keine Chemotherapie mehr´.“
„Ich muss mich trauen, einem Patienten zu raten: `Machen Sie keine Chemotherapie mehr´.“
Viel mehr als eine Sterbebegleitung
Alle Menschen, die auf der Palliativstation behandelt werden, haben schwere, meist unheilbare Erkrankungen. Doch nicht alle sind sterbenskrank. „Die Palliativmedizin ist viel mehr als eine Sterbebegleitung. Sie ist heute eine moderne Disziplin, die im Verlauf einer Krankheit immer wieder ansetzen kann.“ Die palliative Behandlung und Pflege kann die Lebensqualität deutlich verbessern, in einer frühen Phase einer Erkrankung genauso wie am Lebensende. Das Ziel: Belastende Symptome wie Schmerzen, Übelkeit oder Atemnot ausschalten oder so stark eindämmen, dass sie nicht mehr jeden wachen Moment und jeden Gedanken des Patienten beherrschen. Dem Leben Qualität zurückgeben – und dem Menschen die Chance, wieder selbst über seine verbliebene Zeit zu bestimmen.
Auch eine Operation kann palliativ wirken
Die Palliativmedizin arbeitet mit Medikamenten, mit verschiedenen Therapieformen wie der Physio- und Atemtherapie, mit besonderen Ernährungsweisen, Einreibungen, Wärme oder Kältebehandlung und vielen weiteren Verfahren. Dabei tut sie nicht alles, was möglich ist, sondern genau das, was in diesem Moment dem einzelnen Patienten hilft. Das kann auch eine Operation sein. „Wenn ein Patient mit Prostata- und Knochenkrebs zu uns kommt, können wir gegen die Schmerzen natürlich Morphin geben. Wir können auch eine Kernspin-Untersuchung machen und stellen dann vielleicht fest, dass ein Knochenspan ins Rückenmark drückt. Hier kann eine Operation, bei der der Span entfernt wird, dem Patienten noch einige schmerzfreie Wochen schenken.“
Die Würde des Menschen ist unantastbar
Die Palliativstation am Krankenhaus Barmherzige Brüder in München ist die größte in Deutschland, mit 32 Betten und mehr als 110 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die Hälfte von ihnen arbeitet ehrenamtlich. Trotzdem: Palliativpflege ist ein Zuschussgeschäft. Zeit und Zuwendung kosten Geld, das die Aufwandsträger nur teilweise erstatten. Marcus Schlemmer hebt die Augenbrauen: „Raten Sie mal, warum Privatkliniken keine Palliativstationen haben?“ Das Krankenhaus Barmherzige Brüder wird vom gleichnamigen Orden betrieben und ist nicht gewinnorientiert ausgerichtet; die Klinik schließt die Finanzierungslücke mit Spendengeldern und Stiftungen – genauso wie z. B. das Würzburger Juliusspital, das von einer Stiftung getragen wird. Doch Marcus Schlemmer wird auch weiter nicht von Fällen und Pauschalen sprechen, sondern von Menschen und deren ganz individuellen Bedürfnissen. Dafür zitiert er sogar Artikel 1 unseres Grundgesetztes: „Die Würde des Menschen ist unantastbar.“
Lesen Sie weiter …

Warum entscheiden sich Menschen dafür, die Begleitung Sterbender zu ihrem Beruf zu machen? Und woraus schöpfen sie ihre Motivation? Ein Gespräch mit Katarina Theissing (Foto), Pflegekraft im stationären Hospiz und Dozentin für Palliative Care und Hospizarbeit beim Christophorus Hospiz Verein in München.

In Würde leben bis zuletzt, das bedeutet auch: den Kopf freizuhaben für alles, was wichtig ist. Und Lust auf einen Friseurbesuch – wie Frau W. (Foto).